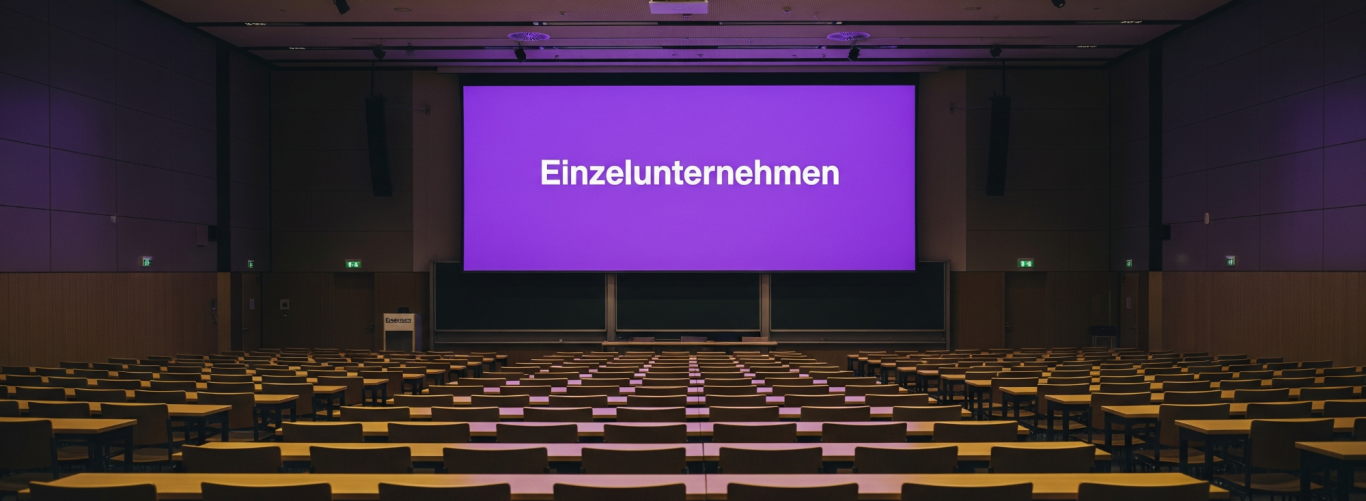
I. Definition und Wesen des Einzelunternehmens
Definition: Ein Einzelunternehmen entsteht automatisch, wenn eine einzelne natürliche Person eine selbstständige, wirtschaftliche Tätigkeit aufnimmt. Es gibt keine zweite Person als Gesellschafter. Der Gründer ist das Unternehmen; es existiert keine rechtliche Trennung zwischen der Privatperson und dem Geschäftsbetrieb.
Zentrale Merkmale:
- Kein Mindestkapital: Es ist keine Kapitaleinlage zur Gründung erforderlich.
- Einfache Gründung: Der Gründungsakt ist im Vergleich zu Kapitalgesellschaften sehr unbürokratisch.
- Volle Kontrolle: Der Inhaber trifft alle Entscheidungen allein und ist allein am Gewinn beteiligt.
- Unbeschränkte Haftung: Dies ist der wichtigste und risikoreichste Aspekt. Der Inhaber haftet für alle Verbindlichkeiten des Unternehmens uneingeschränkt und direkt mit seinem gesamten Geschäfts- und Privatvermögen.
II. Die zwei entscheidenden Typen von Einzelunternehmen
Die Art der Tätigkeit bestimmt den Gründungsablauf und die steuerlichen Pflichten. Diese Unterscheidung ist fundamental.
1. Der Gewerbetreibende
- Definition: Jede unternehmerische Tätigkeit, die nicht als freier Beruf oder land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit gilt. Dies umfasst Handel, Handwerk, Industrie, Gastronomie und die meisten Dienstleistungen.
- Rechtliche Folgen:
- Pflicht zur Anmeldung beim Gewerbeamt.
- Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer (IHK) oder Handwerkskammer (HWK).
- Pflicht zur Zahlung von Gewerbesteuer (allerdings mit einem hohen Freibetrag).
2. Der Freiberufler
- Definition (§ 18 EStG): Eine selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit. Das Gesetz listet Katalogberufe auf (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten, Journalisten, Dolmetscher) und ähnliche Berufe.
- Rechtliche Folgen (Vorteile):
- Keine Gewerbeanmeldung erforderlich.
- Keine Mitgliedschaft in IHK oder HWK.
- Keine Pflicht zur Zahlung von Gewerbesteuer.
III. Der Gründungsprozess: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Der Ablauf unterscheidet sich je nachdem, ob Sie Gewerbetreibender oder Freiberufler sind.
Schritt 1: Vorüberlegungen (für beide Typen)
- Geschäftsidee & Businessplan: Klären Sie Ihr Angebot, Ihre Zielgruppe und Ihre Finanzplanung.
- Firmenname: Freiberufler treten unter ihrem Vor- und Zunamen auf, oft mit einer Tätigkeitsbezeichnung (z.B. "Max Mustermann, Beratung"). Gewerbetreibende müssen ebenfalls ihren vollen Namen verwenden, können aber eine Geschäftsbezeichnung hinzufügen (z.B. "Computerhandel Max Mustermann"). Ein reiner Fantasiename ist nur für im Handelsregister eingetragene Kaufleute (e.K.) möglich.
Schritt 2: Die Anmeldung (Der entscheidende Unterschied)
- Für Gewerbetreibende: Der erste offizielle Schritt ist die Gewerbeanmeldung beim zuständigen Gewerbeamt. Für Ihren Standort wäre dies das Gewerbeamt der Stadt Offenbach am Main. Das Gewerbeamt informiert automatisch weitere Stellen (Finanzamt, IHK/HWK, Berufsgenossenschaft). Bei erlaubnispflichtigen Gewerben (z.B. Gastronomie, Makler) müssen die entsprechenden Genehmigungen vorgelegt werden.
- Für Freiberufler: Sie überspringen den Weg zum Gewerbeamt. Der erste Schritt ist die formlose Anmeldung direkt beim zuständigen Finanzamt (in Ihrem Fall das Finanzamt Offenbach am Main I oder II).
Schritt 3: Steuerliche Erfassung (für beide Typen)
Nach Ihrer Anmeldung sendet Ihnen das Finanzamt den "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" zu. Hier machen Sie Angaben zu Ihrer Person, der Tätigkeit, den erwarteten Umsätzen und Gewinnen. Eine wichtige Entscheidung hierbei ist, ob Sie von der Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) Gebrauch machen möchten. Anschließend erhalten Sie Ihre Steuernummer, die Sie für Rechnungen und Steuererklärungen benötigen.
Schritt 4: Kammer-Mitgliedschaft (nur für Gewerbetreibende) Durch die Gewerbeanmeldung werden Sie automatisch Pflichtmitglied bei der zuständigen IHK (z.B. IHK Offenbach am Main) oder Handwerkskammer.
Schritt 5: Berufsgenossenschaft (für beide Typen) Die Berufsgenossenschaft ist die Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung. Jeder Unternehmer muss sich selbstständig bei der für seine Branche zuständigen Berufsgenossenschaft (BG) anmelden. Dies schützt Sie bei Arbeits- und Wegeunfällen.
Schritt 6: Geschäftskonto eröffnen (dringend empfohlen) Auch wenn rechtlich nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Eröffnung eines separaten Geschäftskontos unerlässlich, um private und geschäftliche Finanzen sauber zu trennen.
Schritt 7 (Optional): Eintrag ins Handelsregister Gewerbetreibende, deren Betrieb einen "in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb" erfordert, müssen sich ins Handelsregister eintragen lassen und werden zum "eingetragenen Kaufmann" (e.K.). Dies bringt erweiterte Pflichten (doppelte Buchführung), aber auch Rechte (Führen eines Fantasienamens, Erteilung von Prokura) mit sich.
IV. Laufende Pflichten und wichtige Aspekte
1. Haftung
Wie bereits erwähnt, ist dies der kritischste Punkt. Sie haften unbeschränkt, unmittelbar und solidarisch mit Ihrem gesamten Privat- und Geschäftsvermögen.
2. Buchführung
- Freiberufler und die meisten Gewerbetreibenden: Es genügt die einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), bei der lediglich die Betriebseinnahmen den Betriebsausgaben gegenübergestellt werden.
- Eingetragene Kaufleute (e.K.) und Gewerbetreibende über bestimmten Umsatz- und Gewinngrenzen sind zur doppelten Buchführung und Bilanzerstellung nach dem HGB verpflichtet.
3. Steuern
- Einkommensteuer: Der Gewinn des Einzelunternehmens wird im Rahmen Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung versteuert.
- Gewerbesteuer (nur für Gewerbetreibende): Auf den Gewerbeertrag wird Gewerbesteuer fällig. Es gibt jedoch einen hohen Freibetrag von 24.500 €. Zudem wird die gezahlte Gewerbesteuer zu einem großen Teil auf die Einkommensteuer angerechnet, was die Belastung oft neutralisiert.
- Umsatzsteuer (VAT): Sie müssen auf Ihren Rechnungen Umsatzsteuer ausweisen und an das Finanzamt abführen, es sei denn, Sie nutzen die Kleinunternehmerregelung.
4. Sozialversicherung
Als Einzelunternehmer sind Sie selbst für Ihre soziale Absicherung verantwortlich. Sie sind in der Regel nicht automatisch in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung pflichtversichert. Sie müssen sich selbst um eine Krankenversicherung (gesetzlich freiwillig oder privat) kümmern und für Ihre Altersvorsorge aufkommen. Für einige Gruppen (z.B. Handwerker, selbstständige Lehrer) kann eine Rentenversicherungspflicht bestehen.
