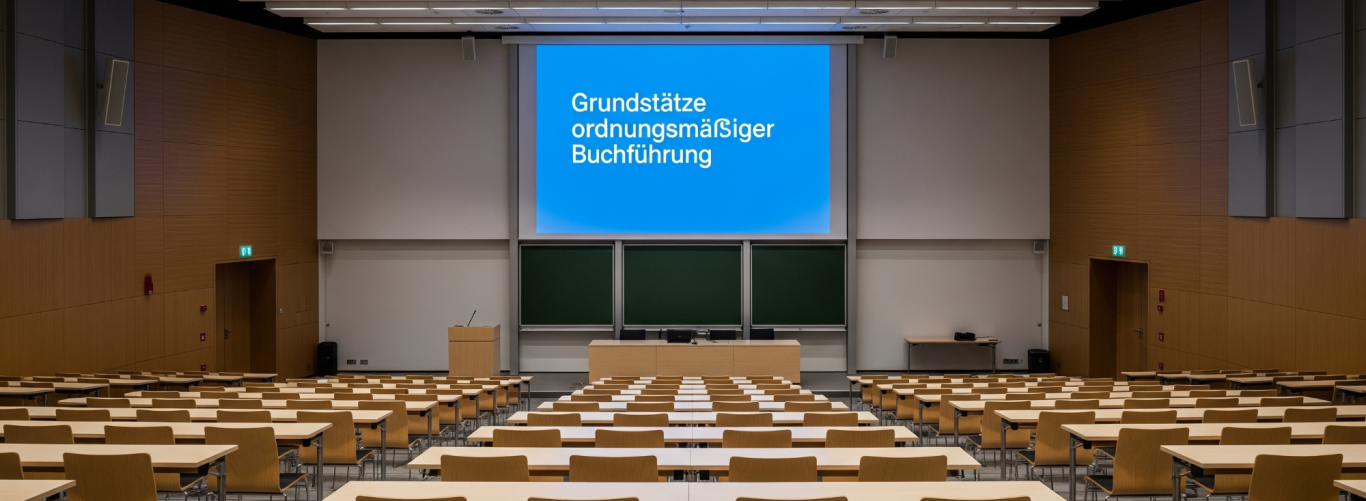
I. Definition, Zweck und rechtliche Verankerung
Was sind die GoB? Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sind ein System von Regeln und Normen, das sicherstellen soll, dass die Buchführung und der daraus abgeleitete Jahresabschluss eines Unternehmens nachvollziehbar, verlässlich, vergleichbar und für sachverständige Dritte (wie Investoren, Banken oder Finanzprüfer) verständlich sind. Sie sollen ein getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermitteln.
Zweck:
- Informationsfunktion: Bereitstellung verlässlicher Informationen für interne und externe Adressaten.
- Dokumentationsfunktion: Lückenlose Erfassung aller Geschäftsvorfälle.
- Schutzfunktion: Insbesondere der Schutz von Gläubigern und Investoren vor falschen oder irreführenden Informationen.
- Maßgeblichkeit für die Besteuerung: Die nach Handelsrecht ordnungsgemäß erstellte Bilanz ist die Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung (Maßgeblichkeitsprinzip).
Rechtliche Verankerung: Die GoB sind kein einzelnes, abgeschlossenes Gesetz. Sie leiten sich aus verschiedenen Quellen ab:
- Gesetzliche Vorschriften: Insbesondere im Handelsgesetzbuch (HGB), z.B. § 238 HGB (Buchführungspflicht) und § 243 HGB (Aufstellungsgrundsätze für den Jahresabschluss), sowie in der Abgabenordnung (AO), z.B. §§ 145-147 AO.
- Rechtsprechung: Viele Grundsätze wurden durch Urteile der Finanz- und Zivilgerichte konkretisiert.
- Wissenschaft und Praxis: Anerkannte betriebswirtschaftliche Lehrmeinungen und langjährige kaufmännische Praxis.
II. Die Kernprinzipien der GoB
Die GoB lassen sich in mehrere übergeordnete Prinzipien unterteilen.
A. Rahmengrundsätze (übergreifende Prinzipien)
- Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit: Alle Buchungen müssen auf belegbaren, tatsächlichen Geschäftsvorfällen beruhen und objektiv nachvollziehbar sein.
- Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit: Die Buchführung muss verständlich, systematisch und übersichtlich aufgebaut sein.
- Grundsatz der Vollständigkeit: Alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle müssen lückenlos erfasst werden ("Keine Buchung ohne Beleg").
- Grundsatz der Einzelbewertung: Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln zu bewerten.
B. Grundprinzipien der Bilanzierung
- Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going Concern, § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB): Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen, solange dem keine tatsächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen.
- Vorsichtsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB): Dies ist ein prägendes Prinzip des deutschen Bilanzrechts. Es verlangt eine tendenziell vorsichtige, risikobewusste Bewertung und gliedert sich in zwei Teile:
- Realisationsprinzip: Gewinne dürfen erst dann ausgewiesen werden, wenn sie am Markt realisiert sind (z.B. durch den Verkauf einer Ware).
- Imparitätsprinzip: Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste müssen bereits dann berücksichtigt werden, wenn sie nur drohen (z.B. durch Bildung von Rückstellungen für mögliche Prozesskosten).
- Grundsatz der periodengerechten Abgrenzung (Accrual Principle, § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB): Aufwendungen und Erträge müssen dem Geschäftsjahr zugeordnet werden, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden, unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung.
III. Die GoBD: Die GoB im digitalen Zeitalter
Die "Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff" (GoBD) sind eine Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums. Sie sind keine neuen Gesetze, sondern konkretisieren und interpretieren die GoB für die digitale Welt. Ihre Einhaltung ist für alle buchführungspflichtigen Unternehmen zwingend.
Kernelemente der GoBD:
- Digitale Belegverarbeitung: Auch digitale Belege (z.B. per E-Mail empfangene Rechnungen) sind aufbewahrungspflichtig. Sie müssen im Originalformat archiviert werden; ein Ausdruck genügt nicht.
- Unveränderbarkeit (Revisionssicherheit): Jede Buchung und jeder digitale Beleg muss so gespeichert werden, dass er nicht nachträglich unbemerkt verändert werden kann. Änderungen müssen protokolliert und nachvollziehbar sein. Dies schließt die Verwendung von Programmen wie Word oder Excel für die laufende Buchführung praktisch aus.
- Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit: Ein sachverständiger Dritter (z.B. ein Betriebsprüfer) muss in der Lage sein, sich innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage des Unternehmens zu verschaffen.
- Zeitgerechte Erfassung: Bargeschäfte müssen täglich, unbare Geschäfte sollten innerhalb von 10 Tagen erfasst werden.
- Verfahrensdokumentation: Jedes Unternehmen muss eine Dokumentation erstellen, die den gesamten datenverarbeitungsgestützten Buchführungsprozess beschreibt: vom Eingang des Belegs über die Erfassung und Verarbeitung bis hin zur Archivierung.
- Datenzugriff der Finanzverwaltung: Im Falle einer Betriebsprüfung muss das Unternehmen dem Prüfer den digitalen Zugriff auf alle steuerrelevanten Daten gewähren (unmittelbarer Lesezugriff, mittelbarer Zugriff oder Datenträgerüberlassung).
IV. Praktische Bedeutung und Konsequenzen bei Verstößen
Die Einhaltung der GoB und GoBD ist kein Selbstzweck. Sie ist die Voraussetzung für die Anerkennung der Buchführung durch das Finanzamt und die Gerichte.
Konsequenzen bei Verstößen: Wird die Buchführung als "nicht ordnungsmäßig" eingestuft, kann dies zur Verwerfung der Buchführung führen. Dies hat schwerwiegende Folgen:
- Hinzuschätzung durch das Finanzamt (§ 162 AO): Wenn die Besteuerungsgrundlagen nicht ermittelt werden können, weil die Buchführung verworfen wurde, ist das Finanzamt berechtigt, die Umsätze, den Gewinn und somit die Steuerschuld zu schätzen. Diese Schätzungen fallen in der Regel sehr zu Ungunsten des Steuerpflichtigen aus.
- Verlust der Beweiskraft: Die Buchführung verliert ihre Beweiskraft in rechtlichen Auseinandersetzungen.
- Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken: Eine fehlerhafte Buchführung kann für die Geschäftsführung zivilrechtliche Haftungsansprüche und im schlimmsten Fall sogar strafrechtliche Konsequenzen (z.B. bei Insolvenz oder Steuerhinterziehung) nach sich ziehen.
