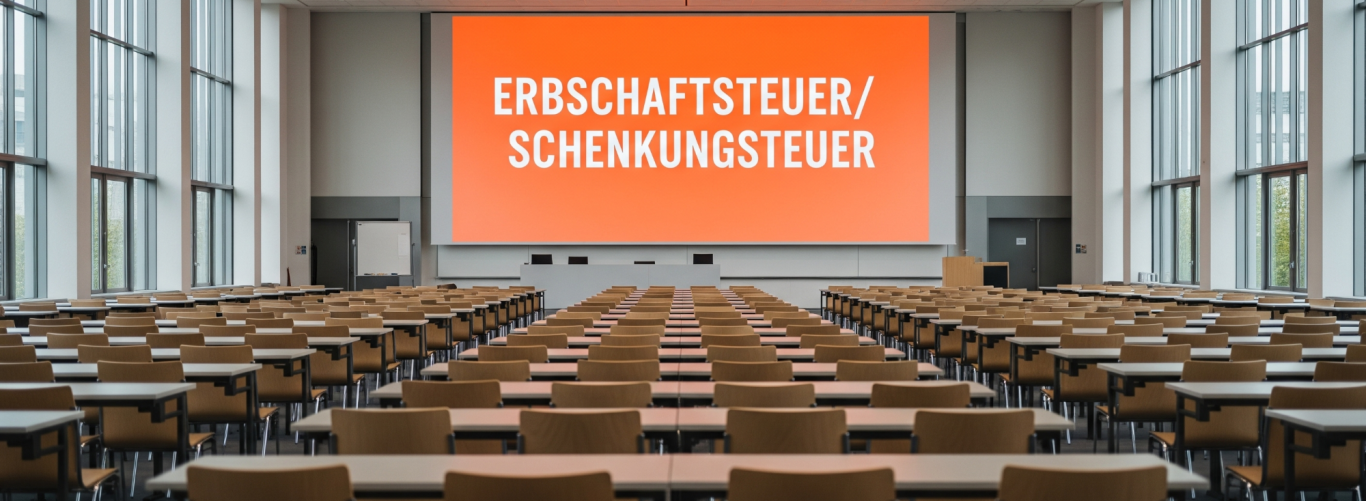
In Deutschland unterliegt der Übergang von Vermögen von einer Person auf eine andere, sei es durch eine Erbschaft nach dem Tod oder durch eine Schenkung zu Lebzeiten, einer Besteuerung. Diese wird durch das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) geregelt. Obwohl es sich um zwei unterschiedliche Anlässe des Vermögenserwerbs handelt, werden sie steuerrechtlich weitgehend gleichbehandelt, um zu verhindern, dass die Erbschaftsteuer durch Schenkungen umgangen wird. Das Steueraufkommen steht den Bundesländern zu.
Grundprinzip der Besteuerung: Die Erbanfallsteuer
Das deutsche System basiert auf dem Prinzip der Erbanfallsteuer. Dies bedeutet, dass nicht der Nachlass als Ganzes besteuert wird, sondern der individuelle Erwerb bei jedem einzelnen Begünstigten (Erbe, Vermächtnisnehmer oder Beschenkter). Die Höhe der Steuer bemisst sich nach der Höhe der persönlichen Bereicherung und dem Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser oder Schenker. Jeder Erwerber ist für die auf seinen Anteil entfallende Steuer selbst verantwortlich.
Persönliche Steuerpflicht
Die Steuerpflicht knüpft an die Person des Erblassers/Schenkers oder des Erwerbers an. Eine unbeschränkte Steuerpflicht besteht, wenn eine dieser Personen ein Inländer ist, also ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. In diesem Fall wird das gesamte Weltvermögen der Besteuerung unterworfen. Sind weder der Erblasser/Schenker noch der Erwerber Inländer, greift die beschränkte Steuerpflicht, die sich nur auf bestimmtes Inlandsvermögen (z.B. Immobilien oder Betriebsvermögen in Deutschland) bezieht.
Die drei Steuerklassen
Das Gesetz teilt die Erwerber je nach ihrem Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser oder Schenker in drei Steuerklassen ein. Diese Einteilung ist entscheidend für die Höhe der Freibeträge und der anwendbaren Steuersätze.
- Steuerklasse I: Hierzu gehören die engsten Familienangehörigen wie der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner, die Kinder und Stiefkinder. Auch die Enkelkinder fallen in diese Klasse, ebenso wie die Eltern und Voreltern bei einem Erwerb von Todes wegen (nicht jedoch bei Schenkungen).
- Steuerklasse II: Diese Klasse umfasst entferntere Verwandte, namentlich die Eltern und Voreltern bei Schenkungen, Geschwister, Nichten und Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und geschiedene Ehegatten.
- Steuerklasse III: In diese Steuerklasse fallen alle übrigen Erwerber, also nicht verwandte Personen wie Freunde oder auch juristische Personen.
Persönliche Freibeträge
Um eine übermäßige Belastung zu vermeiden und kleine bis mittlere Vermögensübertragungen steuerfrei zu stellen, gewährt der Gesetzgeber persönliche Freibeträge. Diese können alle zehn Jahre erneut in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Erfolgen innerhalb dieses Zeitraums mehrere Erwerbe von derselben Person, werden diese zusammengerechnet, und der Freibetrag wird nur einmal gewährt.
Die Höhe der Freibeträge ist nach der Steuerklasse gestaffelt:
- Ehegatten und eingetragene Lebenspartner (Steuerklasse I) haben einen Freibetrag von 500.000 Euro.
- Kinder und Stiefkinder sowie Enkelkinder, deren Eltern bereits verstorben sind (Steuerklasse I), profitieren von einem Freibetrag von 400.000 Euro.
- Enkelkinder, deren Eltern noch leben (Steuerklasse I), können einen Freibetrag von 200.000 Euro geltend machen.
- Andere Personen der Steuerklasse I (z.B. Eltern beim Erwerb von Todes wegen) haben einen Freibetrag von 100.000 Euro.
- Für alle Erwerber der Steuerklassen II und III gilt ein einheitlicher und deutlich niedrigerer Freibetrag von 20.000 Euro.
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Freibeträgen gibt es besondere Versorgungsfreibeträge für den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner (bis zu 256.000 Euro) und für Kinder bis zum Alter von 27 Jahren (gestaffelt zwischen 10.300 und 52.000 Euro), die jedoch gekürzt werden, wenn der Erwerber steuerfreie Versorgungsbezüge erhält.
Steuersätze
Der auf den steuerpflichtigen Erwerb – also den Wert des Erwerbs nach Abzug der Freibeträge und Verbindlichkeiten – anzuwendende Steuersatz richtet sich ebenfalls nach der Steuerklasse und der Höhe des verbleibenden Betrags. Grundsätzlich gilt: Je näher das Verwandtschaftsverhältnis und je geringer der Wert des Erwerbs, desto niedriger der Steuersatz.
- Steuerklasse I: Die Steuersätze beginnen bei 7 Prozent für einen steuerpflichtigen Erwerb bis 75.000 Euro und steigen progressiv an bis zu einem Spitzensteuersatz von 30 Prozent für Erwerbe über 26 Millionen Euro.
- Steuerklasse II: Hier liegen die Steuersätze zwischen 15 Prozent und 43 Prozent.
- Steuerklasse III: Für nicht verwandte Erwerber gelten die höchsten Steuersätze, die bei 30 Prozent beginnen und bei Erwerben über 13 Millionen Euro auf 50 Prozent ansteigen.
Bewertung des Vermögens
Die Grundlage für die Berechnung der Steuer ist der Wert des übertragenen Vermögens zum Zeitpunkt der Steuerentstehung (Todestag oder Tag der Schenkung). Grundsätzlich wird der sogenannte gemeine Wert angesetzt, was dem am Markt erzielbaren Verkaufspreis entspricht. Für bestimmte Vermögensarten gibt es jedoch spezielle Bewertungsregeln im Bewertungsgesetz (BewG):
- Immobilien: Unbebaute und bebaute Grundstücke werden mit ihrem Verkehrswert bewertet. Dieser wird in der Regel durch standardisierte Verfahren (Vergleichswert-, Ertragswert- oder Sachwertverfahren) ermittelt. Ein im zeitlichen Zusammenhang mit dem Erbfall erzielter Kaufpreis kann ebenfalls als Nachweis des Verkehrswerts dienen.
- Betriebsvermögen: Die Bewertung von Unternehmen ist komplex und erfolgt in der Regel nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren oder auf Basis von Verkäufen unter Fremden. Ziel ist es, den Fortführungswert des Unternehmens zu ermitteln.
- Wertpapiere und Bankguthaben: Diese werden mit dem Kurswert bzw. dem Nennwert am Stichtag angesetzt.
Vom ermittelten Wert des Vermögens können Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden. Dazu zählen die Schulden des Erblassers, aber auch die Kosten der Bestattung, Grabpflege und die Kosten für die Abwicklung des Nachlasses, für die ein Pauschbetrag von 10.300 Euro ohne Nachweis angesetzt werden kann.
Steuerbefreiungen und besondere Vergünstigungen
Das Gesetz sieht eine Reihe von Steuerbefreiungen vor, um bestimmte Vermögenswerte zu schützen und die Unternehmensnachfolge zu erleichtern.
- Familienheim: Die wohl wichtigste Befreiung betrifft das selbstgenutzte Wohneigentum. Der Erwerb eines Familienheims durch den Ehegatten/Lebenspartner ist vollständig steuerfrei, sofern dieser die Immobilie für weitere zehn Jahre selbst zu Wohnzwecken nutzt. Eine Ausnahme von der Weiternutzungspflicht besteht nur bei zwingenden Gründen (z.B. Umzug in ein Pflegeheim). Auch Kinder können das Familienheim steuerfrei erben, wenn die Wohnfläche 200 Quadratmeter nicht übersteigt und sie es ebenfalls unverzüglich für zehn Jahre selbst nutzen.
- Hausrat und andere bewegliche Gegenstände: Für Hausrat gibt es je nach Steuerklasse Freibeträge von bis zu 41.000 Euro, für andere bewegliche Gegenstände bis zu 12.000 Euro.
- Betriebsvermögen: Um die Fortführung von Unternehmen und den Erhalt von Arbeitsplätzen nicht zu gefährden, gibt es weitreichende Verschonungsregeln. Im Rahmen der Regelverschonung können 85 Prozent des begünstigten Betriebsvermögens steuerfrei bleiben, wenn der Erwerber das Unternehmen fünf Jahre lang fortführt und bestimmte Lohnsummenregelungen einhält. Unter noch strengeren Voraussetzungen (siebenjährige Behaltensfrist, höhere Lohnsummen) ist sogar eine vollständige Steuerbefreiung im Rahmen der Optionsverschonung möglich. Diese Vergünstigungen gelten jedoch nur für das sogenannte begünstigte Vermögen; schädliches Verwaltungsvermögen (z.B. nicht betriebsnotwendige liquide Mittel, vermietete Grundstücke) ist nur eingeschränkt oder gar nicht begünstigt.
Verfahren und Anzeigepflicht
Jeder der Erbschaft- oder Schenkungsteuer unterliegende Erwerb muss dem zuständigen Finanzamt innerhalb von drei Monaten nach Kenntniserlangung schriftlich angezeigt werden. Dies gilt sowohl für den Erben bzw. Beschenkten als auch für den Schenker. Eine Ausnahme besteht, wenn der Erwerb auf einer von einem deutschen Gericht oder Notar eröffneten Verfügung von Todes wegen beruht und sich aus dieser das Verhältnis zum Erblasser zweifelsfrei ergibt. Bei Schenkungen, die notariell beurkundet werden, übernimmt der Notar die Anzeigepflicht.
Auf Grundlage der Anzeige prüft das Finanzamt, ob eine Steuer anfallen könnte. Nur wenn es das für erforderlich hält, fordert es den Erwerber zur Abgabe einer Erbschaft- oder Schenkungsteuererklärung auf und setzt dafür eine Frist. Nach Prüfung der Erklärung erlässt das Finanzamt einen Steuerbescheid, aus dem sich die festgesetzte Steuer und die Zahlungsfrist ergeben.
